SIEGEN Schüler des Löhrtor-Gymnasiums haben sich mit dem ganz alltäglichen Rassismus beschäftigt
Die SZ überlässt den Schülerinnen in diesem Artikel das Wort
sz ◼ Man kennt das - nach einem entspannten Feiertag mit der ganzen Familie in abendlicher Festtagsstimmung das zweijährliche Beisammensein ausgiebig zelebrieren und gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Bis zum Hauptgang läuft alles glatt - doch alles nimmt eine ungnädige Wendung, als Opa nach der Soße ungarischer Art fragt, allerdings nicht mit exakt diesen Worten, und sich damit einen unsanften Stoß seiner Enkelin in die Rippen einhandelt. Daraufhin entfacht sich eine hitzige Debatte über die korrekte Bezeichnung für besagte Soße. Wenn Oma zu allem Überfluss noch mit einigen Schaumküssen auf dem Präsentierteller das Esszimmer betritt, läuft das Fass vollkommen über. Wutentbrannt schlägt Opa seine Faust auf den Tisch und nicht viel später fällt der Satz: „Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!“
Aber wo ist die Grenze tatsächlich? Wo fängt Rassismus an und was macht er mit den Betroffenen? Diese Fragen lassen sich am besten beantworten, wenn man sie einfach den Personen stellt, die diese Äußerungen auch betreffen.
Jasmin Mouissi ist Trainerin für Empowerment und Anti-Rassismus. Sie hat langjährige Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Empowerment-Workshops für Menschen mit Rassismuserfahrung und Eltern von Schwarzen Kindern (die Selbstbezeichnung von Schwarzen Menschen ist ‚Schwarz‘ mit großem Anfangsbuchstaben) sowie in der rassismuskritischen Arbeit mit weißen Menschen.
„Das ist hier in Deutschland so ein Phänomen, dass alle direkt an krasse Gewalt denken, an Nazis, an Glatzen, an Leute, die einen Hitlergruß zeigen, Springerstiefel, Bomberjacken. Das ist so das Bild, wenn man an einen Rassisten denkt, aber was eben wichtig ist, ist zu sehen, dass Rassismus noch viel mehr ist als dieser Extremismus,“ erzählt sie uns im Interview. Dieser Rassismus sei jedoch viel schwieriger zu erkennen als ein Parolen brüllender Nazi.
Er verstecke sich in Blicken, Taten, vermeintlicher Neugierde und Komplimenten, was es auch so kompliziert mache, offen über diese subtile Form von Rassismus zu sprechen. Oftmals fühlten sich Menschen dadurch in eine Ecke gestellt, in der sie sich selbst nicht verorten würden. So wird ein ehrlicher und gut gemeinter Verbesserungsvorschlag, wie in der zu Beginn beschriebenen Situation, schnell als eine persönliche Anfeindung aufgegriffen und vehement abgewehrt. Mouissi betont daher: „Rassismus sitzt einfach mitten in unserer Gesellschaft“. Er befindet sich nicht nur am Rand, sondern wird immer und immer wieder reproduziert und findet sich in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch in Institutionen wie Schulen und Behörden.
Von klein auf werden uns rassistische Verhaltensweisen und Begrifflichkeiten, oft indirekt, beigebracht, weshalb dieses Verhalten ohne es zu hinterfragen übernommen wird. Deshalb ist es auch so essenziell, über subtilen Rassismus und generelle Diskriminierung im Sprachgebrauch zu sprechen. Und genau das wollen wir mit diesem Artikel.
„Rassismus kann Menschen wirklich körperlich und psychisch krank machen“, das können sich die meisten vorstellen. Aber wie allgegenwärtig Rassismus für Schwarze Menschen und PoC (=People of Colour, selbstgewählte Bezeichnung von Menschen, die nicht-weiß positioniert werden und dementsprechend Rassismuserfahrungen machen) ist und wie verletzend Worte sein können, ist vielen unklar.
So berichtet Frau Mouissi, dass Rassismus schon vor der Geburt beginnen könne, wenn über den vermeintlichen Teint der Haut debattiert wird. Weiter geht es dann im Kindergarten, wenn die Haut mit bestimmten Lebensmitteln verglichen wird. Nicht selten kommt es zu direkten rassistischen Anfeindungen. Fest steht: Schwarze Kinder werden häufig damit konfrontiert, als fremd, nicht-zugehörig und anders wahrgenommen zu werden. Besonders für Jugendliche in der Findungsphase ist dies eine zusätzliche Belastung, da sie häufig rassistische Fremdzuschreibungen verinnerlicht haben, d.h. auch an diese Konstruktionen über sich glauben und sich wünschen, anders auszusehen.
Frau Mouissi erzählt von psychosomatischen Symptomen wie Bauch- und Kopfschmerzen, über die die Kinder klagen. 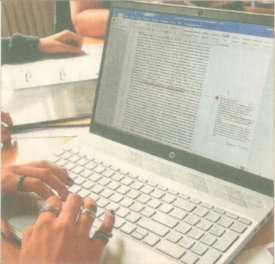 Von Rassismus betroffene Personen müssen mit all diesen enormen Herausforderungen umgehen lernen, was einen großen Kraftaufwand bedeuten kann. Sie fühlen sich nicht gesehen und daher minderwertig, was auch zur sozialen Isolation führen kann. „Für Eltern von Schwarzen Kindern ist das eine ganz schmerzhafte Erkenntnis, dass sie ihre Kinder vor Rassismus ja gar nicht schützen können, weil er passieren wird,“ erzählt Mouissi.
Von Rassismus betroffene Personen müssen mit all diesen enormen Herausforderungen umgehen lernen, was einen großen Kraftaufwand bedeuten kann. Sie fühlen sich nicht gesehen und daher minderwertig, was auch zur sozialen Isolation führen kann. „Für Eltern von Schwarzen Kindern ist das eine ganz schmerzhafte Erkenntnis, dass sie ihre Kinder vor Rassismus ja gar nicht schützen können, weil er passieren wird,“ erzählt Mouissi.
In den Workshops erarbeitet sie mit Eltern, wie diese ihre Kinder aber für den Umgang mit Rassismus stärken können, ihnen Werkzeug an die Hand geben können. Dazu gehört zum Beispiel offen mit den Kindern über Rassismus zu sprechen, um der Verinnerlichung von rassistischer Diskriminierung gezielt entgegenzuwirken, und für Repräsentation zu sorgen, zum Beispiel durch das Umfeld, aber auch durch Serien, Filme oder Bücher mit Schwarzen Personen in individuellen und nicht stereotypisierten Rollen. Außerdem bietet sie Workshops an, in denen Schwarze Menschen sich austauschen, Wissen über die Mechanismen, welche hinter dem Rassismus stehen, mit dem sie konfrontiert werden, erlangen und gemeinsam Strategien im Umgang mit Rassismus entwerfen können.
Weiße Menschen unterstützt sie bei der Auseinandersetzung mit Privilegien, welche sie als weiße Person im Kontext von Rassismus haben. Dazu gehört auch das Privileg, sich nicht aktiv mit Rassismus auseinandersetzten zu müssen. Aber erst, wer sich aktiv mit Rassismus auseinandersetzt, wird ihn auch in seinem Sprachgebrauch identifizieren können. Dazu sagt Mouissi: „Das sehe ich auch in meiner Arbeit immer wieder, dass das für die  Teilnehmenden ganz schön anstrengend ist, weil sie aus dieser Komfortzone raus müssen und sich an die eigene Nase fassen müssen. Das ist für sie oft ganz unangenehm, aber gleichzeitig lohnt sich diese Auseinandersetzung total, weil eben so die Welt rassismusärmer gestaltet werden kann.“
Teilnehmenden ganz schön anstrengend ist, weil sie aus dieser Komfortzone raus müssen und sich an die eigene Nase fassen müssen. Das ist für sie oft ganz unangenehm, aber gleichzeitig lohnt sich diese Auseinandersetzung total, weil eben so die Welt rassismusärmer gestaltet werden kann.“
Diskriminierung durch Sprache betrifft aber nicht nur Schwarze Menschen und PoC, sondern auch Angehörige verschiedenster Religionen. Wir haben mit Herrn Sander gesprochen, einem Vorsitzenden der „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“. Er selbst ist Jude und schon oft mit Antisemitismus in Kontakt gekommen. Erstmalig als Kind, durch Angehörige, die den Holocaust noch miterlebt und überlebt haben, aber auch in der Arbeitswelt durch lustig gemeinte Sprüche von Kollegen und einem antisemitischen Chef.
Antisemitismus im Sprachgebrauch, so sagt er, habe oft mit Verallgemeinerungen zu tun, also mit Unterstellungen, die auf alle Angehörigen des Judentums übertragen werden. Das kann aus Unwissenheit passieren, allerdings auch absichtlich boshaft, wenn eine Person auf Grund eines sogenannten „geschlossenen Weltbildes“ dem Judentum feindselig gegenübersteht. „Also wenn ich ein Kommunist und Antisemit bin, dann sind die Juden für mich kapitalistisch, und wenn ich Kapitalist und Antisemit bin, sind die Juden für mich kommunistisch,“ führt Sander dieses geschlossene Weltbild weiter aus.
Aber auch wer nicht offen antisemitisch eingestellt ist, kann sich dennoch unabsichtlich antisemitischer Begriffe bedienen.  Als Beispiele gibt er Worte jiddischen Ursprungs an, die im Deutschen allerdings ausschließlich negativ konnotiert verwendet werden, so zum Beispiel „Maloche“ (=Arbeit) oder „Mischpoche“ (=Familie). Viele Menschen verwenden den Begriff Jude selbst noch als Schimpfwort, weshalb wiederum häufig von „Menschen jüdischen Glaubens“ die Rede ist. Allerdings ist Jude weder ein Schimpfwort noch eine Fremdbezeichnung, wie es zum Beispiel beim Z- oder N-Wort der Fall ist. Juden bezeichnen sich selbst auch als Juden.
Als Beispiele gibt er Worte jiddischen Ursprungs an, die im Deutschen allerdings ausschließlich negativ konnotiert verwendet werden, so zum Beispiel „Maloche“ (=Arbeit) oder „Mischpoche“ (=Familie). Viele Menschen verwenden den Begriff Jude selbst noch als Schimpfwort, weshalb wiederum häufig von „Menschen jüdischen Glaubens“ die Rede ist. Allerdings ist Jude weder ein Schimpfwort noch eine Fremdbezeichnung, wie es zum Beispiel beim Z- oder N-Wort der Fall ist. Juden bezeichnen sich selbst auch als Juden.
„Die Juden wissen, dass sie immer aufmerksam sein müssen und müssen feststellen, wann Antisemitismus gefährlich wird und wann aus Worten auch Taten werden,“ meint Sander. Das ist leider oft auch der Knackpunkt. Man kann nicht wissen, wer es ernst meint mit seinen Drohungen und wer nicht, man kann nicht wissen, ob eine Person, die antisemitische Sprache verwendet, dies aus Unwissenheit tut oder weil sie wirklich antisemitisch eingestellt ist. Daher müssen Juden immer aufmerksam sein, was natürlich bei nicht-jüdischen Menschen in der Regel nicht der Fall ist. „Aber wer sich die Frage stellt “Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen”, hat schon eigentlich den entscheidenden Schritt gemacht. Eine Person, die sich informieren will, die nicht antisemitisch sein will, bei einer solchen Person mache ich mir keine Gedanken. Diejenigen, die sich die Gedanken nicht machen, die sich nicht die Frage stellen, da besteht die Gefahr,“ meint Sander.
Denjenigen, die Antisemitismus aktiv in ihrem Sprachgebrauch vermeiden wollen, rät er, sich über bestimmte Worte und ihre Herkunft zu informieren und sich an die Stelle eines Betroffenen zu stellen, um dann zu überlegen, welche Begriffe einen selbst persönlich verletzen würden. Abschließend betont er aber erneut: „Deshalb helfen meine Tipps auch nicht, denn wer die Tipps hören möchte, der hat schon den entscheidenden Schritt gemacht.“
Wer  Herrn Sanders Worte beachtet und sich wirklich Gedanken macht, gerät deutlich weniger oft in die Bredouille. Zur Not hilft Nachfragen immer, Kontakt und Kommunikation bringen mehr Licht und Durchblick in dieses dunkle Thema. Diskriminierung äußert sich in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen, bei dem Großteil der Menschen glücklicherweise unabsichtlich. Trotzdem haben Worte die Fähigkeit, Betroffene zu verletzen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, nicht Teil der Gesellschaft zu sein. Sprache und Rassismus hängen sehr eng zusammen. Deswegen ist es so wichtig, auch über die Frage nach den richtigen Worten zu reden und das am besten nicht an Stelle von Betroffenen, sondern mit ihnen gemeinsam.
Herrn Sanders Worte beachtet und sich wirklich Gedanken macht, gerät deutlich weniger oft in die Bredouille. Zur Not hilft Nachfragen immer, Kontakt und Kommunikation bringen mehr Licht und Durchblick in dieses dunkle Thema. Diskriminierung äußert sich in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen, bei dem Großteil der Menschen glücklicherweise unabsichtlich. Trotzdem haben Worte die Fähigkeit, Betroffene zu verletzen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, nicht Teil der Gesellschaft zu sein. Sprache und Rassismus hängen sehr eng zusammen. Deswegen ist es so wichtig, auch über die Frage nach den richtigen Worten zu reden und das am besten nicht an Stelle von Betroffenen, sondern mit ihnen gemeinsam.
Rassismus und rassistische Vorurteile abzubauen ist ein langer Weg, wenn aber jeder bei sich selbst anfängt und sich ernsthaft fragt, welche Worte lieber aus dem Wortschatz gestrichen werden sollten, und das nicht nur aus Empörung über die Maßregelung der Enkelin am Esstisch, dann wird der Weg um einiges kürzer.


